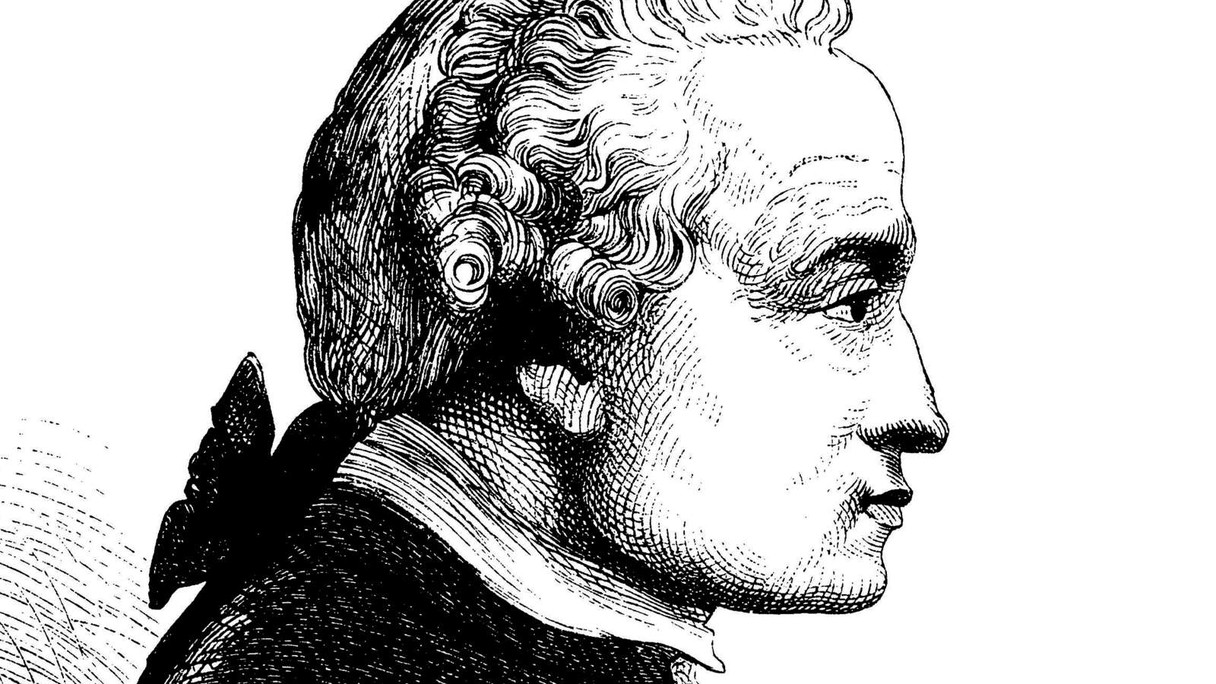«Frohbotschaft statt Drohbotschaft!» – Mit diesem Slogan wird in der Kirche dazu aufgerufen, einen barmherzigen Gott zu predigen statt eines strafenden Weltenrichters, der überwacht, ob die Gebote der Bibel und Vorschriften der Kirche eingehalten werden. Religion darf den Menschen nicht Angst machen: Dem hätte Kant zugestimmt, eine Petition an den Papst aber nicht unterschrieben. Denn einen «Kirchenglauben», bei dem allein ein Bischof oder eine Institution über Religion, Glauben und Wahrheit entscheiden, lehnte er ab. Es gehe auch nicht darum, Gott gefallen zu wollen, beispielsweise durch Opfer, Fasten oder langes Beten; das sind für Kant «Fetische», ohne sittlichen Nutzen, die zu einem «Religionswahn» führen und vom Klerus zum eigenen Nutzen bewirtschaftet werden. Vielmehr dürfe sich in einer aufgeklärten Welt «Religion» nur «innerhalb der Grenzen der blos-sen Vernunft» bewegen, so der Titel seiner längsten Schrift über Religion und Kirche.
Was kann ich wissen?
Anders als die französischen Aufklärer wollte der Philosoph aus Königsberg, der seine Heimat zeitlebens nicht verlassen hat, nicht die Kirche oder den christlichen Glauben zerstören. Das lag zunächst wohl an seiner protestantisch-pietistischen Prägung, in deren Zentrum Bibelgläubigkeit, Gebetsfrömmigkeit und der Dienst am Nächsten standen. Gelehrte Theologie aber nicht, denn sie war überflüssig für eine «praktische Philosophie» – so bezeichnete er die Moral. Zudem war der calvinistisch erzogene preus-sische König Friedrich Wilhelm I. (er regierte von 1713 bis 1740) davon überzeugt, dass das marode Land nur wiederaufgebaut werden könne, wenn es sich am Pietismus orientiert – und an den klassischen Tugenden wie Ordnung, Fleiss, Sparsamkeit oder Toleranz, die heute als preussische Tugenden bekannt sind.
Auch Kant war vom Nutzen von Religion überzeugt. Für ihn war sie allerdings «eine reine Vernunftsache», und ihr Zweck bestehe allein darin, sich und die Gesellschaft zum Besseren zu entwickeln. Theologische Spekulationen darüber, wie und wer Gott ist, gehören nicht dazu, denn Gott geht über alles hinaus, was mit dem Verstand erfasst werden kann. Mehr als dass es sich bei Gott um eine «absichtlich-wirkende oberste» und «verständige Ursache» handle – also die Quelle eines moralischen Prinzips, lasse sich deshalb nicht sagen. «Man kann die Existenz Gottes nicht beweisen, aber man kann nicht umhin, nach dem Prinzip einer solchen Idee zu verfahren und Pflichten als göttliche Gebote anzunehmen.» Hier ist die Schwachstelle in seiner Philosophie, denn Kant «braucht» die Idee eines verpflichtenden höheren Wesens, einen obersten moralischen Gesetzgeber. Ohne diese Instanz lässt sich nämlich nicht erklären, woher der Mensch weiss, was moralisch gut ist. Was Kant Gott nennt, ist vor allem eine Erklärungshilfe für die Ursache von Ethik und Moral. Mit den klassischen Gottesbildern von einem personalen Wesen mit menschlichen Charakterzügen, zu dem man sprechen kann und das einen «versteht», tat sich Kant deshalb schwer.
Auch Kant glaubte, dass Gottes Willen in der Bibel zu finden ist. Sie müsse zwar von «Schriftgelehrten» (Theologinnen und Theologen) übersetzt und für heute erklärt werden. Die Auslegung aber bewirke Gott selbst, indem er «durch unsere eigene (moralisch-praktische) Vernunft spreche». Das ist der Kern von Kants Vernunftreligion, die über der Theologie steht und frei ist von allem, was nicht «die moralische Besserung des Menschen» fördert. Eine Vernunftreligion ist frei von Glaubenswahrheiten, die kaum jemand versteht, für wahr hält oder glaubt, frei auch von kirchlichen Vorschriften, die unvernünftig scheinen. Als Katholik hätte Kant heute womöglich mit der oft beklagten strukturellen Benachteiligung von Frauen in der Kirche oder auch mit dem Eherecht seine Schwierigkeiten.
Was soll ich tun?
Religion ist dann vernünftig, wenn ich so handle, «dass die Maxime [m]eines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte». Dieser sogenannte kategorische Imperativ geht über die Goldene Regel («Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.») hinaus: Ich besitze nicht den Massstab für meine Moral. Aber ich kann durch Vernunft meinen Willen so bilden, dass er das moralisch Gute will. Nun schliesst sich der Kreis: Meine Vernunft kann nur deshalb wissen, was moralisch gut ist, weil es ein verpflichtendes moralisches Gesetz gibt, das aus Gott kommt und in mir wirkt. Durch die Religion können die moralischen Pflichten, die jedem Menschen zukommen, als göttliche Gebote erkannt werden.
Doch nicht immer lässt sich so handeln, dass es absolut gut ist; es gibt Wertekonflikte und moralische Dilemmata. Dann sei «die Vernunft auch befugt, allenfalls eine übernatürliche Ergänzung gläubig anzunehmen», also auf Gottes Hilfe zu setzen. Und so resümiert Kant: «Moral führt unausbleiblich zur Religion.» Allerdings geht der Inhalt einer solchen Religion kaum über blosse Ethik hinaus.
Was darf ich hoffen?
Anfangs begrüsste Kant die Französische Revolution, weil er hoffte, dass sie den Gedanken der Aufklärung politisch schneller durchsetzt und sich so die Menschen weiter verbessern – und mit ihnen die Gesellschaft. Seine Hoffnung gründete darauf, dass Gottes moralisches Prinzip durch die Vernunft wirkt. Die Vernunft führt das Wollen und Handeln aller zur «Herrschaft des guten Prinzips». Diese wird vom Gewissen eines jeden Menschen abgesichert.
Doch Kant musste miterleben, dass eine ewige Glückseligkeit im Sinne eines irdischen «Reiches Gottes» weit entfernt war: Die Revolution, noch im Geiste der Aufklärung begonnen, radikalisierte sich und ersetzte die Religion mit der Guillotine. Kant war entsetzt: Unter moralischem Fortschritt der Menschheit verstand er etwas anderes. Doch er gab die Hoffnung nicht auf, dass sich die Vernunft irgendwann durchsetzen und ein allumfassendes ethisches Gemeinwesen als «Vereinigung aller Rechtschaffenen» entstehen werde.
Auf eine leibliche Auferstehung oder das himmlische Paradies hoffte er hingegen nicht. Das wäre wohl zu unvernünftig.
Zum Autor
Markus Zimmer ist Kirchenhistoriker und Musikwissenschafter
Tipp
Die für diesen Beitrag benutzten Quellen und ausgewählte Schriften über Immanuel Kant sowie diesen Text mit Anmerkungen finden Sie bis 14. November 2024 im Lesesaal der Jesuitenbibliothek Zürich. Viele Titel können auch im Buchhandel bezogen werden.