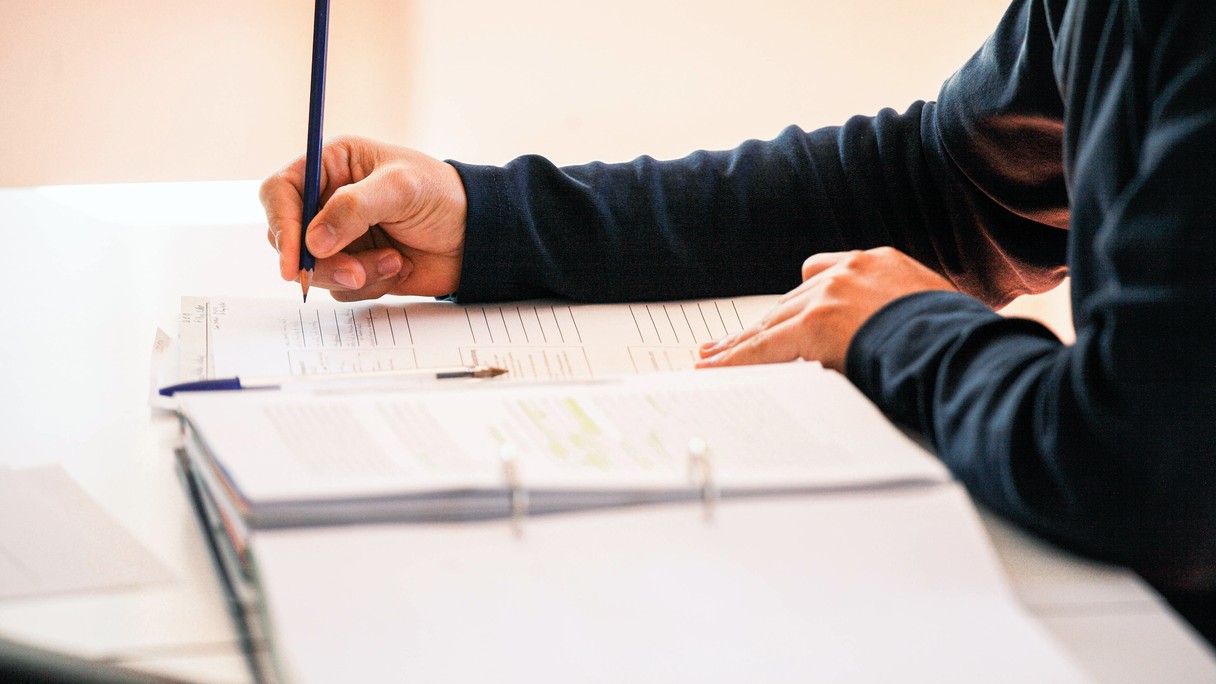Mit dem Dekret der Diözesanbischöfe vom 27. März ist es offiziell: Die psychologischen Assessments für angehende Priester, Seelsorgerinnen und Seelsorger werden in allen Schweizer Bistümern eingeführt. Anfang April startet zunächst eine Pilotphase, die bis Ende 2025 dauern soll. Die Massnahme war von den Bischöfen anlässlich der Veröffentlichung der Vorstudie zu Missbrauch in der Schweizer Kirche im Herbst 2023 versprochen worden. Damit soll bereits bei der Zulassung von Mitarbeitenden das Risiko für Übergriffe und schädigendes Verhalten reduziert werden. Bischof Joseph Maria Bonnemain, der die Missbrauchsprävention in der Schweizer Bischofskonferenz vorantreibt, sagt zu den verpflichtenden Tests: «Wir schulden das den Menschen, die sich der Kirche anvertrauen und ein Recht haben, dass ihre Integrität ausreichend geschützt ist.» Gleichzeitig schulde man dies aber auch jenen Personen, die sich für einen kirchlichen Dienst ausbilden liessen. Es gehe darum, «ihr Entwicklungspotenzial frühzeitig abzuklären» und sie «gezielt zu fördern».
Die Kosten für die Tests tragen die Bistümer, für die die jeweiligen Kandidaten und Kandidatinnen studieren. Sie belaufen sich auf rund 5 000 Franken pro Assessment. Für die Pilotphase steht ein begrenztes Kontingent an Tests zur Verfügung. Getestet werden sollen zunächst jene Personen, die am Ende ihrer Ausbildung stehen und ab Herbst 2025 ihre Arbeit im Umfeld Kirche beginnen wollen. Späterhin will man auch Personen den Tests unterziehen, die aus dem Ausland oder aus anderen kirchlichen Ausbildungsstrukturen jenseits der Bistümer die Arbeit aufnehmen, so heisst es im Dekret der Bischöfe. Seelsorgerinnen und Seelsorger, die fertig ausgebildet im Einsatz sind, sollen nur dann für ein Assessment in Betracht gezogen werden, wenn sie «während ihrer pastoralen Tätigkeit Auffälligkeiten zeigen» und sich Nachholbedarf in Bezug auf «Basiskompetenzen, psychische Verfasstheit, charakterliche Ausgeglichenheit oder affektive Reife» zeige.
Bereits 1988 war von der Schweizer Bischofskonferenz eine Rahmenordnung für die Ausbildung erlassen worden, die das Einholen psychologischer Gutachten vorsieht. 2016 hatte das römische Dikasterium für den Klerus festgelegt, dass Bischofskonferenzen Normen zu erlassen haben, um die Modalitäten dazu zu regeln. Bischof Bonnemain: «Die psychologischen Abklärungen, die bereits seit Jahren Teil der Ausbildung waren, wurden nun weiterentwickelt und neben dem kompetenzorientierten durch einen forensischen Blick ergänzt.»
So war der Schweizer Psychologe und Forensiker Jérôme Endrass an der Entwicklung des Assessments federführend beteiligt. Der stellvertretende Leiter des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich gilt als Spezialist im Bereich der Risikoeinschätzung bei Gewalt- und Sexualstraftätern. Die Zusammenarbeit mit der Kirche hat er als «nur positiv» erlebt, nun müsse man das Ergebnis testen und Erfahrungen damit sammeln. «Ob sich erfüllt, was sich die Verantwortlichen erhoffen und ob es für sie einen Mehrwert gibt, muss die Kirche entscheiden.» Ein Urteil darüber treffen zu können erwartet er in drei bis vier Jahren. Endrass hält fest, dass es bei psychologischen Assessments nicht um «Daumen rauf oder runter» gehe. So gebe es auch kein bestehen oder nicht bestehen, im Gegenteil: «Man überprüft, wie gut eine Person mit den geforderten Grundkompetenzen übereinstimmt und hat eine Möglichkeit, das zu objektivieren.» Objektivieren, also konkrete, vergleichbare Werte zu Eigenschaften einer Persönlichkeit vorlegen zu können und eine externe Einschätzung zu erhalten gilt als Mehrwert von psychologischen Assessments. «Wir legen Ergebnisse vor, geben aber keine direktive oder gar bindende Empfehlung ab. Die Anstellungsentscheidung liegt einzig beim Arbeitgeber.» Durchgeführt wird das Assessment von psychologischen Gutachterinnen, die positive wie negative Aspekte erfassen: Im Positiv-Assessment gehe es darum, Potenziale und Fähigkeiten einer Person zu eruieren, im negativen Bereich um die Abklärung von Risiken. «Das Ziel ist nicht primär, Menschen auszuschliessen, die Probleme mitbringen, sondern vielmehr herauszufinden, wer sich wofür besonders gut eigenen könnte.»
Und was, wenn kirchliche Verantwortliche Ergebnisse und Einsichten aus den Tests unter den Tisch fallen liessen? Endrass relativiert: «Dieses Problem beschränkt sich bei weitem nicht auf die Kirche.» Er sieht die Einführung der psychologischen Assessments als «ersten Schritt, um mehr Transparenz zu schaffen». Nun müsse man der Kirche die Chance geben, einen Umgang damit zu finden.
Stefan Loppacher, Leiter der Dienststelle Missbrauch im kirchlichen Kontext, sieht in der Frage nach dem Umgang mit den Testergebnissen «eine der grossen Herausforderungen, die noch nicht abschliessend geklärt» sei. Er verweist auf «verschiedene Rechtsgüter», die sensibel gegeneinander abgewogen werden müssten: einerseits das Interesse an Transparenz und professioneller Personalführung, andererseits etwa der Persönlichkeitsschutz und der Schutz der Integrität der Auszubildenden.
Wenn die Fachpersonen klar abraten, werde ich mich an die Empfehlung halten.
Bischof Bonnemain möchte die Ergebnisse der Assessments ernst nehmen, selbst im Fall eines belastenden Resultats: «Wenn die psychologischen Fachpersonen bei einer bestimmten Person klar von einer künftigen Beschäftigung als Seelsorger oder Seelsorgerin abraten, werde ich mich an diese Empfehlung halten.» Für ihn sei das Assessment ein «sehr wichtiges, aber nicht das einzige» Entscheidungselement.
Insgesamt zeigt sich Bonnemain «sehr zufrieden» damit, wie die Tests nun konzipiert seien und dass man für die Erarbeitung international anerkannte Fachleute gewinnen hätte können. Loppacher sieht darüber hinaus einen Meilenstein erreicht, sei doch die Zusammenarbeit zwischen Religion und Psychologie in den letzten Jahrhunderten «keine Erfolgsstory» gewesen. Hier nun sei es gelungen, Übersetzungsarbeit zu leisten und theologische, kirchliche Sprache in die der Psychologie zu übersetzen. Jérôme Endrass nennt ein Beispiel: «Die kirchlichen Fachpersonen haben die Fähigkeit zur Selbstkritik als notwendige Qualifikation genannt. Wir haben das operationalisiert in Introspektionsfähigkeit – diese lässt sich mit psychologischer Methodik erfassen.»
Grundlage für die Arbeit der Psychologinnen und Psychologen war ein Qualifikationsprofil für Seelsorgerinnen und Seelsorger, das der Bildungsrat der katholischen Kirche in der Deutschschweiz bereits 2023 erarbeitet hatte. Man habe Synergien nützen können, freut sich Loppacher. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Jérôme Endrass hatte seit Frühjahr 2024 die Entwicklung vorangetrieben. Neben Endrass gehörten die forensische Psychologin Astrid Rossegger und die Fachpsychologin für Laufbahn- und Personalpsychologie Rahel Bader dem Team an; von kirchlicher Seite waren dabei Generalvikar Markus Thürig als Präsident des Bildungsrates, Bischof Bonnemain, Daniel Krieg und Nicolas Glasson als Regenten, also Leiter von Priesterseminaren, Céline Ruffieux als bischöfliche Beauftragte für die Bistumsregion des Kantons Freiburg, darüber hinaus Brigitta Minich und Theres Küng, die als Seelsorgerinnen im Dienst des Bistums Basel stehen, Julian Miotk vom Religionspädagogischen Institut, Stefan Mayer als reformierter Bereichsleiter Seelsorge der Landeskirche Aargau sowie Stefan Loppacher als Leiter der Dienststelle Missbrauch im kirchlichen Kontext.