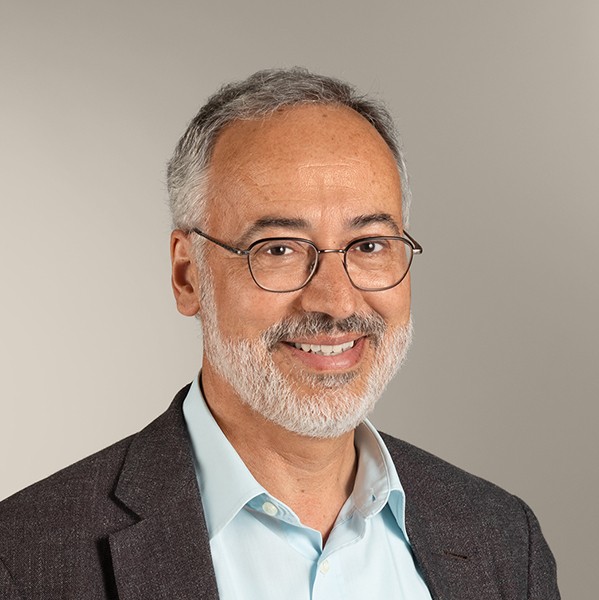
Daniel Süss ist Professor für Medienpsychologie an der ZHAW und Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Zürich.
zvg
Nachrichten sollen Orientierung geben, auf Gefahren und Lösungsmöglichkeiten hinweisen und Entscheidungen fundieren. So jedenfalls lauten die Vernunftsgründe – aber da ist noch mehr: Sie liefern Gesprächsstoff, befriedigen die Neugier oder sind als Soft-News einfach unterhaltsam. Sich gemeinsam über etwas aufzuregen, tut offenbar auch gut. Aber erfreuliche Botschaften brauchen wir noch viel mehr für unser Wohlbefinden. Nur erscheinen positive Nachrichten und Lösungsorientierungen selten, nach dem Motto der Medienbranche «Good News are no News», was dazu führt, dass schon fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung sich von Nachrichten abwendet und dadurch unterversorgt ist. Das zeigen aktuelle Studien des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich. Derselbe Trend ist auch in anderen Ländern der Welt sichtbar. Dieser ist besonders bei jungen Menschen ausgeprägt. Qualitätsjournalismus hat einen schweren Stand, obwohl auch junge Menschen den Boulevardmedien und den Sozialen Medien wenig vertrauen, wie Studien der ZHAW zeigen. Trotzdem scrollen sie lieber durch Online-Feeds als in Zeitungen zu blättern. Bezahlt wird heute mit Aufmerksamkeit, mit Lebenszeit und persönlichen Daten.
Ein Merkmal unserer digitalisierten Gesellschaft ist die Beschleunigung im Nachrichtenfluss: von der Wochenschau zur Tagesschau, zu stündlichen News, zu permanenten News-Updates. Reizüberflutung führt zu einem permanenten Alarmiertheitszustand, einem Dauerstress, der zu Hilflosigkeit führt, Nachlassen der Aufmerksamkeit und Rückzug ins Private. Der Neuropsychologe Lutz Jäncke hat in seinem Buch «Von der Steinzeit ins Internet. Der analoge Mensch im digitalen Zeitalter» aufgezeigt, dass unser Gehirn sich schwertut mit den vielen Hinweisreizen aus der digitalen Umwelt. Wer nicht immer wieder zum Smartphone greift, erlebt die Angst etwas zu verpassen. Und wer mal am Scrollen ist, wird – vom Algorithmus gelenkt – mit immer mehr Desselben konfrontiert.
Auf Sozialen Medien wie Instagram, TikTok oder X zirkuliert ein Potpourri von seriösen Inhalten, Verschwörungsmythen und Fake News. Diese auseinander zu halten, fällt vielen schwer. Also lässt man sich von Emotionen lenken: Je sensationeller oder empörender ein Inhalt daherkommt, desto mehr Klicks löst er aus. In der Folge wird das Menschen- und Weltbild immer düsterer.
Deshalb kann man versucht sein, sich ganz abzuschotten: «Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss.» Ignoranz um des Wohlbefindens willen. Sinnvoller erscheint mir aber Entschleunigung beim News-Konsum: sich bewusst entscheiden, welche Quellen man in welchem Rhythmus nutzen möchte, Rituale der Medienzuwendung entwickeln, die einem gut tun und Gewohnheiten, die Stress auslösen, ändern.
Qualitätsjournalismus ist nicht kostenlos zu haben – aber ist seinen Preis auch Wert. Und vor allem: Wer am (nahen und fernen) Weltgeschehen Anteil nimmt und politisch engagiert ist, braucht relevante News, aber auch den Austausch mit anderen Menschen, um die News einzuordnen und Lösungsansätze zu diskutieren. Und für die Psychohygiene ist es hilfreich, die «Nachrichten-Bilanz» jeden Tag persönlich anzureichern mit der Frage: Was habe ich heute erfahren und erlebt, was positiv war und Hoffnung macht?