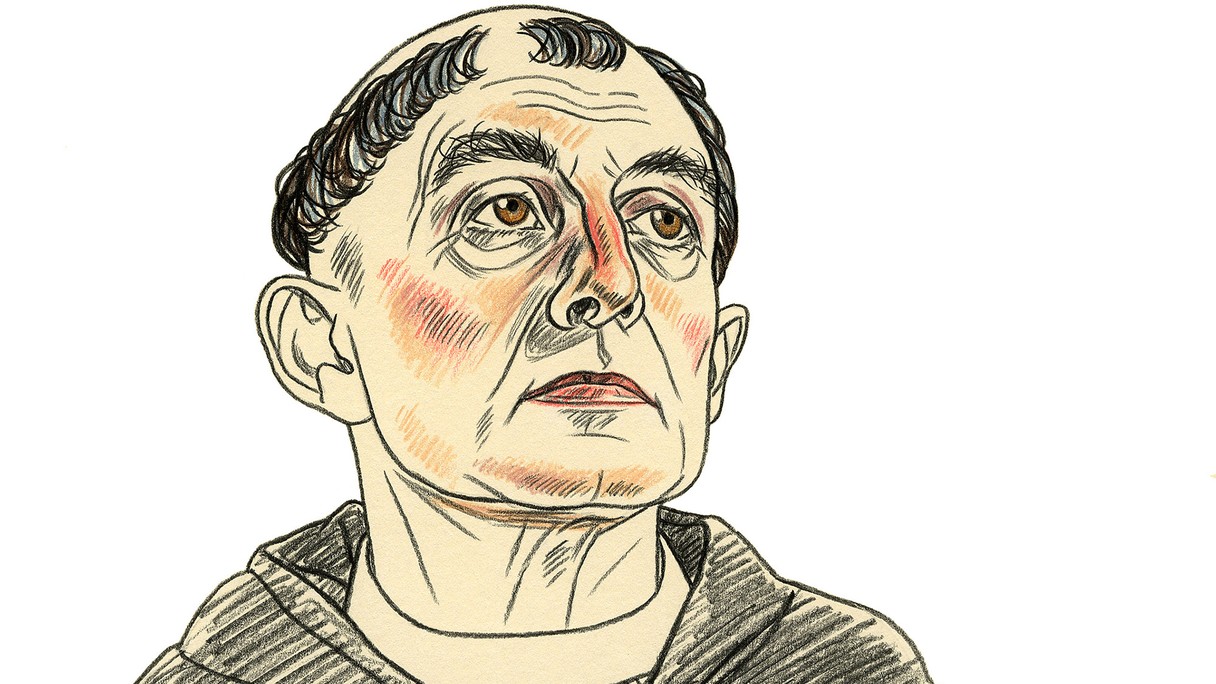Nie hat Anselm die Glaubensaussagen angezweifelt, die er in der Schule von Aosta am südlichen Fuss des Mont-Blanc gelernt hatte. Als er mit Anfang zwanzig ins Benediktinerkloster Bec in der Normandie eintritt, nimmt er theologische Studien bei seinem verehrten Lehrer, dem Abt Lanfranc, auf. Anselm gibt sich aber bald nicht mehr damit zufrieden, die Glaubenssätze nur zu kennen, er will sie auch intellektuell verstehen. Doch die vielen widersprüchlichen Erklärungsversuche, die sich in den tausend Jahren seit Jesu Tod am Kreuz in der Theologie angesammelt haben und unverbunden nebeneinanderstehen, helfen ihm wenig. Für sich genommen, ergeben die Teile einen Sinn, aber kein Ganzes. Deshalb konzentriert sich Anselm in seinen Studien darauf, seinen «Glauben, der nach Einsicht sucht» verstehbar, logisch und zusammenhängend zu erklären.
Als Lanfranc von Wilhelm dem Eroberer nach der Einnahme Englands zum Erzbischof von Canterbury berufen wird, beginnt Anselms Karriere. Er wird erst Prior, dann Abt der Benediktinerabtei Bec. Neben den damit verbundenen administrativen Aufgaben findet Anselm die Zeit, Bücher zu schreiben: In «Selbstgespräch» (Monologion, 1076) und «Ansprache» (Proslogion, 1077/78) versucht Anselm, Gott zu beweisen, indem er sagt, es könne nichts Grösseres gedacht werden als Gott, deshalb müsse Gott das absolut Grösste sein, das existiert. Doch was er schreibt, gefällt nicht allen. Ein Vorwurf: Mit seinen Spekulationen erhebe er sich über Gott, weil er vorgebe, Gott zu verstehen.
Auch die Dreifaltigkeit nimmt Anselm nicht einfach hin, sondern erforscht deren innere Notwendigkeit. Den Heiligen Geist schildert er als eine alles verbindende Liebe, und seine Aufgabe sei es, dem Menschen Einsicht in die Grösse und das Geheimnis Gottes zu vermitteln. Über den Sohn Gottes folgert er: Jesus ist wirklich Mensch und dennoch ganz und gar Gott; er ist sterblich und zugleich ewig.
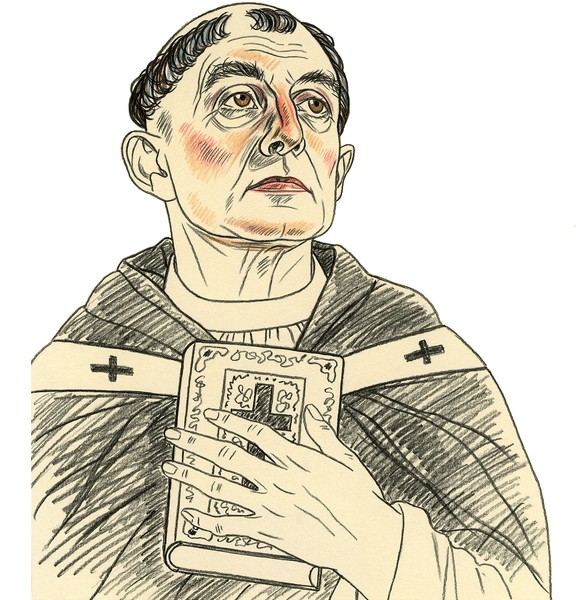
Agata Marszałek
«Warum ist Gott Mensch geworden?»
Anselm von Canterbury, um 1033–1109
Weil Anselm erstmals den Glauben wirklich erklärt, sind seine Schriften heiss begehrt. Dank seines Rufs und seiner Bekanntheit am englischen Hof folgt er seinem ehemaligen Lehrer Lanfranc auf den Stuhl des Erzbischofs von Canterbury. Statt theologischer Fragen stehen nun Politik und Leitungsaufgaben auf seiner Agenda, doch er steht weiterhin mit dem Kloster in Bec in Verbindung. Und so trägt Bosco, der Anselm als Abt von Bec nachfolgte, die Bitte an ihn heran, der Frage nachzugehen, welche Funktion Jesus, der Sohn, für die Menschheit hat. Anselm macht sich an die Arbeit, doch erst nach vier Jahren, als er wegen eines Zerwürfnisses mit dem englischen König ins Exil gehen muss, gelingt es ihm, diese Schrift abzuschliessen. Er gibt ihr den Titel: Warum Gott ein Mensch geworden ist.
Darin entwickelt Anselm eine ganz neue Erlösungslehre. Bis dahin wurde die Erlösung des Menschen durch Jesu Tod mit der Täuschungstheorie erklärt: Der Teufel habe demnach einen Anspruch darauf, den Menschen wegen der Erbsünde mit dem Tod zu bestrafen. Als Jesus, scheinbar ein Mensch wie alle anderen, sich freiwillig in den Tod gab, habe er den Teufel getäuscht, denn weil Jesus ohne Erbsünde war, habe er keine Strafe verdient. Durch diese falsche Strafe habe der Teufel sein Recht auf Bestrafung verloren. Verbreitet war auch die Annahme, Gott habe durch Christus die Menschheit aus der Herrschaft des Teufels freigekauft. Beide Erklärungen lehnt Anselm ab.
Zwar verdiene der Mensch Gottes Strafe, weil er dessen Ehre unendlich verletzt habe, doch Gottes Barmherzigkeit überlasse ihn nicht seinem Schicksal. Denn Gott wolle ihn von seiner Schuld erlösen, damit er in den Himmel aufgenommen werden kann. Doch vorher müsse der Mensch sich vom «Schmutz der Sünde» reinigen und Gott gegenüber freiwillig die Schuld für die Sünde begleichen, um sich mit Gott zu versöhnen. Theologisch ausgedrückt: Er muss Genugtuung leisten. Das sei der Menschheit aber gar nicht möglich, zu gross sei die Schuld: Mit der Ursünde Adams und Evas habe der Mensch die Unsterblichkeit, die ihm von Gott geschenkt wurde, aufs Spiel gesetzt und verloren.
Deshalb, so Anselm, braucht es einen Gott-Menschen, Jesus Christus, der die nötige Genugtuung leistet: Weil sie so gross ist, kann er sie nur als Gott leisten. Zugleich muss er es als Mensch tun, weil der Mensch die Schuld auf sich geladen hat. Und schliesslich muss Christus freiwillig und nur zu diesem einen Zweck den Tod auf sich nehmen, um für die Schuld aller anderen einzustehen, beginnend bei Adam und Eva und für alle Zeiten. Weil dies von Anfang an seine Aufgabe war, ist Gott in Jesus ganz Mensch geworden und zugleich vollständig Gott geblieben.
Obwohl es ihm nicht um Struktur- oder Machtfragen ging, sondern um den Kern des Glaubens, wurde seine Schrift geleakt: Noch bevor er sie abgeschlossen hatte, kopierten Mönche ohne sein Wissen den ersten Teil.
Und heute? Können «echte» Glaubensfragen die Christinnen und Christen bewegen? Fühlen sie sich noch erlösungsbedürftig – und wenn ja, wovon?
Die Schriften Anselms und hilfreiche Literatur stehen in der Jesuitenbibliothek Zürich bereit.